Am 15. Oktober 1978, meinem letzten Arbeitstag und zufällig genau an meinem 54. Geburtstag, brachte mich mein Fahrer zum letzten Male in die Zentrale nach Dearborn. Vor dem Verlassen meines Hauses küsste ich meine Frau Mary und meine beiden Töchter Kathie und Lia. Meine Familie hatte während der letzten turbulenten Ford-Monate arg gelitten, und das erfüllte mich mit Wut. Eigentlich war ich selbst für mein Schicksal verantwortlich. Aber warum Mary und die Mädchen? Warum mussten sie da durch? Sie waren unschuldige Opfer eines Tyrannen, dessen Name an dem Gebäude stand.

Noch heute verspüre ich Schmerz. Es ist wie mit der Löwin und ihren Jungen. Wenn der Jäger keinen Ärger will, lässt er die Kleinen in Ruhe. Henry Ford peinigte meine Kinder, und das werde ich ihm nie vergeben.
Vor meiner Präsidentschaft erlebte ich Henry ziemlich abweisend. Später war mein Büro genau neben seinem im Glashaus, und wir sahen uns recht häufig, wenn auch nur in Sitzungen. Doch je näher ich Henry Ford kennenlernte, umso mehr sorgte ich mich um die Zukunft des Unternehmens – und um meine.
Herr über Leben und Tod
Das Glashaus war ein Palast, und Henry regierte unangefochten. Wann immer er das Gebäude betrat, erstarb jedes Wort: Der König war angekommen. Manchmal standen unsere leitenden Chargen auf den Fluren herum und hofften, ihm über den Weg zu laufen. Wenn sie Glück hatten, nahm Mister Ford von ihnen Notiz und sagte: „Hallo“. Gelegentlich ließ er sich sogar herab, mit ihnen zu reden.
Jedes Mal, wenn Henry in eine Sitzung kam, änderte sich sofort die Atmosphäre. Er war für alle von uns Herr über Leben und Tod. Er konnte völlig überraschend sagen: „Kopf ab!“ – und das machte er oft. Ohne sachliche Diskussion endete so manche vielversprechende Karriere bei Ford im Dreck.
Bei Henry zählte nur Oberflächliches. Auf gepflegte Erscheinungen fiel er leicht herein. Wenn jemand die richtige Kleidung trug und die passenden Worte säuselte, war Henry beeindruckt. Aber ohne den schönen Schein – vergiss den Knaben.

Eines Tages gab mir Henry den Befehl, einen unserer Top-Manager zu entlassen. Er war nach seiner Auffassung ein Schwuler. „Seien Sie nicht kindisch“, sagte ich. „Der Typ ist einer meiner guten Kumpel. Er ist verheiratet und hat ein Kind. Wir essen zusammen.“ „Schmeiß ihn raus“, wiederholte Henry, „er ist ein Schwuler.“ „Was reden Sie?“ sagte ich. „Schau ihn dir doch an. Seine Hosen sind zu eng.“ „Henry“, sagte ich ruhig, „was haben denn seine Hosen damit zu tun?“ „Er ist andersrum“, sagte Henry. „Er hat ein weibisches Gehabe. Schmeiß ihn raus.“
Willkür als Glaube
Der willkürliche Gebrauch der Macht war nicht nur ein Charakterfehler. Für Henry war das wie eine Art Glaube. Zu Anfang meiner Präsidentschaft hatte mir Henry einmal seine Management-Philosophie erläutert: „Wenn einer für dich arbeitet, lass es ihm nicht zu angenehm werden“, sagte er. „Er soll sich nicht gemütlich fühlen. Tu immer das Gegenteil von dem, was er erwartet.“
Man muss sich fragen, warum der Vorsitzende der Ford Motor Company, einer der mächtigsten Männer der Erde, sich wie eine ungeratene Göre aufführte. Was machte ihn so? Vielleicht liegt der Grund darin, dass Henry nie in seinem Leben für irgendetwas arbeiten musste. Vielleicht liegt auf reichen Kindern, die ihr ganzes Geld nur erben, ein Fluch. Sie spazieren durchs Leben wie durch ein Tulpenfeld und fragen sich, was sie wohl ohne ihren Papi geworden wären. Arme Leute beklagen oft, dass ihnen niemand eine Chance gibt; aber der reiche Junge weiß nie, ob er auch allein etwas erreicht hätte. Niemand sagt ihm je die Wahrheit.
Jeder erzählt ihm nur, was er hören will.
Mir scheint so, als ob Henry Ford II, Enkel des Gründers der Ford Motor Company, sein ganzes Leben darunter gelitten hat, er könnte alles vermasseln. Vielleicht schien er sich deswegen so bedroht zu fühlen und stets auf der Hut vor irgendwelchen Palastrevolutionen zu sein: Zwei Leute, die sich auf dem Flur unterhalten, könnten ja schon eine Verschwörung planen.
Ich will nicht den Psychologen spielen, aber ich kann mir seine Ängste erklären. Als Henry noch jung war, lebte sein Großvater in ständiger Furcht vor Kidnappern. Die Kinder wuchsen hinter verschlossenen Türen auf mit Leibwächtern, misstrauisch jedem gegenüber, der nicht zur näheren Verwandtschaft gehörte.
Fiesta, ein Knochen in der Kehle
Auch in den ersten Jahren hatten wir schon unser Päckchen an Meinungsverschiedenheiten. Aber ich war immer bemüht, die Beherrschung zu bewahren. Ernsthafte Auseinandersetzungen führte ich nur privat mit ihm, wenn Gelegenheit für ein offenes Gespräch war. Als Präsident konnte ich keine Zeit mit belanglosen Diskussionen verbringen. Ich musste in großen Zeiträumen denken. Wo etwa sollte die Gesellschaft in fünf Jahren stehen?

Kleinwagen waren wie Knochen in Henrys Kehle. Aber ich bestand darauf, einen kleinen Fronttriebler zu machen – wenigstens in Europa. Sogar Henry konnte einsehen, dass so ein Kleinwagen in Europa Sinn hat. In nur 1.000 Tagen stellten Hai Sperlich, unser Produktplanungs-Chef, und ich einen nagelneuen Wagen auf die Räder. Der Fiesta war sehr klein, mit Frontantrieb und querliegendem Motor. Er war herrlich. Ich wusste, wir hatten einen Gewinner.
20 Jahre lang hatten uns die Erbsenzähler bei Ford Gründe dafür geliefert, dass wir so ein Auto niemals bauen sollten. Aber jetzt widersetzten sich sogar die Spitzenleute in unserer europäischen Division dem Fiesta. Der für internationale Angelegenheiten zuständige Vizepräsident sagte mir, dass Phil Caldwell, damals Präsident von Ford Europa, absolut dagegen war, weil sich der Fiesta nicht verkaufen lasse, und wenn doch, dass nicht ein Pfennig damit zu verdienen wäre.
Henry liebte Europa
Aber ich wusste, dass wir ihn machen mussten. Ich ging in Henrys Büro: „Unsere Jungs in Europa wollen dieses Auto nicht. Ich brauche Rückendeckung und nicht jemand, der es hinterher besser weiß – wie beim Edsel. Wenn Sie nicht mit Herz und Seele dabei sind, sollten wir es vergessen.“ Henry sah Licht. Schließlich stimmte er der Investition von einer Milliarde Dollar für den Fiesta zu. Und das war gut so. Der Fiesta war ein außergewöhnlicher Erfolg. Ob es Henry glaubte oder nicht: Der Fiesta rettete ihn in Europa und war so entscheidend für unsere Wende wie der Mustang in den Sechzigern.
Henry mochte die Japaner nicht sonderlich, dafür liebte er Europa. Zu Hause in Amerika, besonders nach dem Vietnam-Debakel, war Autorität immer weniger gefragt. In Europa war das noch ganz anders. Familienbesitz bedeutete etwas. In Europa gab es noch das alte Klassensystem, die Heimat des Großgrundbesitzes, der Paläste und der königlichen Familien. In Europa interessierten sich die Leute noch dafür, wer die Großeltern gewesen waren.
Nur Wein, Weib und Gesang
Eines denkwürdigen Abends war ich mit Henry in Deutschland auf einem Rhein-Schloss. Geld spielte keine Rolle, wenn es zur Unterhaltung Henry Fords diente. Als wir nach oben gingen, fielen mir die Augen aus dem Kopf. Da spielte eine Blaskapelle in Lederhosen eine Willkommensmelodie. Als Henry langsam den Burggraben durchschritt, die Treppenstufen emporstieg, folgte die musizierende Kapelle. Es hätte gerade noch gefehlt, dass sie „Heil dem Führer“ intoniert hätten.
Wo auch immer Henry in Europa auftauchte, traf er sich mit den edelsten Familien, war mit ihnen stets auf du und du, trank herum und war richtig glücklich, dabei zu sein. Er war so begeistert von Europa, dass er oft davon sprach, seinen Lebensabend dort zu verbringen. Einst kam er sogar auf Sardinien zu einer Party des Jetset mit einer amerikanischen Flagge auf dem Hosenboden. Die Europäer waren beleidigt, aber Henry fand seinen Einfall super. So wie ich ihn sah, war Henry immer ein Playboy. Er hat nie hart gearbeitet. Er spielte hart. Richtig interessierten ihn nur Wein, Weib und Gesang.
Ford demontierte Iacocca
1975 begann Henry Ford, mich vorsätzlich zu demontieren. Bis dahin hatte er mich machen lassen. Aber in diesem Jahr fingen seine Brustschmerzen an, und er sah wirklich nicht besonders gut aus. König Henry war klar geworden, dass auch er sterblich war. Er wurde zum Tier. Seine Eingebung war etwa so: „Ich möchte diesen italienischen Eindringling nicht an der Spitze sehen. Was passiert mit der Familie, wenn ich einen Schlag bekomme und sterbe?“
Im selben Winter gaben wir den Zwölf-Millionen-Dollar-Verlust für das vierte Quartal 1974 bekannt. Die Summe war nicht besonders groß. Verglichen mit dem, was die Autoindustrie zwischen 1979 und 1982 durchgemacht hatte, waren die zwölf Millionen eher ein Grund zum Feiern. Aber es war seit 1946 das erste Mal, dass die Ford Motor Company ein schlechtes Quartals-Ergebnis hatte: ein weiterer Punkt neben seiner nachlassenden Gesundheit und seiner kriselnden Ehe, über den sich Henry Sorgen machen musste.

Hier-stinkt-es-Gesicht
Damals hieß meine Sekretärin Betty Martin, eine außergewöhnliche Frau. Ohne unsere übliche Männerwirtschaft hätte Betty bei Ford Vizepräsident sein müssen – sie war fähiger als die meisten meiner Mitarbeiter. Betty wusste immer, wenn sich etwas Verdächtiges abspielte. Eines Tages sagte sie mir: „Jedes Mal, wenn Sie über die Unternehmens-Kreditkarte telefonieren, geht eine Aufzeichnung an Mister Fords Büro.“ Einige Wochen später sagte sie: „Ihr Schreibtisch ist immer ziemlich durcheinander. Manchmal räume ich auf, bevor ich gehe. Ich weiß immer genau, wo ich was hingelegt habe. Aber am nächsten Morgen ist alles wieder verändert. Ich glaube nicht, dass es die Putzfrauen sind.“
Am nächsten Morgen ging ich wie gewöhnlich zur Arbeit. Im Büro war kein Anzeichen von irgendwelchen Besonderheiten. Kurz vor drei Uhr bestellte mich Henrys Sekretärin in sein Büro. „Jetzt kommt’s“, dachte ich. Im Allerheiligsten saßen Henry und sein Bruder Bill am marmornen Konferenztisch mit einem Hier-stinkt-es-Gesicht. Sie schienen streng und nervös.
Merkwürdigerweise fühlte ich mich ganz locker. Ich hatte Bill nicht erwartet, aber seine Anwesenheit war nur logisch. Sie sollte glauben machen, dass die ganze Sache nicht allein von Henry, sondern von der Familie kam.
Henry delegierte die Drecksarbeit
Außerdem brauchte Henry einen Zeugen und Beistand. Normalerweise delegierte er die Drecksarbeit an andere Leute – besonders an mich. Jetzt musste er sie tun. Und mit seinem Bruder an der Seite war es einfacher. Auch ich fühlte mich deshalb besser. Bill war ein Bewunderer von mir, sogar so etwas wie ein Freund. Er hatte immer Hilfe versprochen, wenn es einmal hart auf hart gehen sollte. Doch ernsthafte Hilfe konnte ich nicht erwarten; Bill hatte sich nie gegen seinen Bruder aufgelehnt. Henry hatte noch nie jemand gefeuert, und er wusste nicht, wie er es anfangen sollte. „Es kommt die Zeit“, sagte er schließlich, „wo ich die Dinge in die Hand nehmen muss. Ich habe beschlossen, das Unternehmen neu zu organisieren. Das ist so eine Situation, die man verabscheut und dennoch tun muss. Es war eine nette Zusammenarbeit“ – ich schaute ihn ungläubig an – „aber ich denke, Sie sollten gehen. Es ist das Beste für die Firma.“
Kein einziges Mal während unseres 45 Minuten dauernden Gesprächs benutzte er das Wort „gefeuert“. „Warum das Ganze?“ fragte ich ihn. Henry konnte keine richtige Antwort geben. „Es ist persönlich“, sagte er, „mehr kann ich dazu nicht sagen. Das ist halt so.“ Ich hakte nach. Ich wollte eine Erklärung, weil ich wusste, dass er keine gute hatte. Schließlich zuckte er mit den Schultern und sagte: „Well, manchmal kann man jemand nicht leiden.“
Der Rausschmiss bei Ford
Mir blieb nur noch eine Karte: „Und was macht Bill hier?“ sagte ich, „ich möchte gern wissen, was er denkt.“ – „Ich habe bereits entschieden“, sagte Henry. Ich war enttäuscht, aber nicht überrascht. Blut ist dicker als Wasser, und Bill gehörte zur Dynastie. „Ich habe bestimmte Rechte“, sagte ich, „und ich hoffe, darüber gibt es keine Diskussion.“ Es ging um meine Abfindung. „Das kriegen wir klar“, sagte Henry.
Kurz vor Ende des Gesprächs machte Bill einen ehrlichen Versuch, die Meinung des Bruders zu ändern. Aber es war zu spät. Als wir das Büro verließen, liefen Tränen über Bills Wangen. „Das hätte nicht passieren dürfen“, sagte er, „er ist rücksichtslos.“
Als ich in mein Büro zurückkam, riefen schon einige Freunde und Kollegen an. Mein Rausschmiss war also durch. Beim Nachhause gehen fühlte ich Erleichterung. „Gottseidank ist dieser Mist vorüber“, sagte ich zu mir selbst im Auto. Wenn schon gefeuert, dann war wenigstens der Zeitpunkt gut: Wir hatten gerade die besten sechs Monate unserer Firmengeschichte hingelegt.
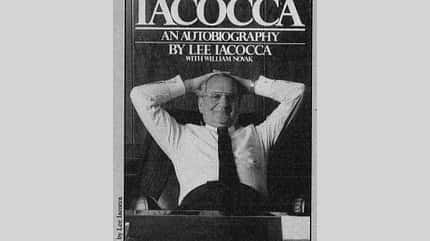
Zu Hause rief mich Lia an, die jüngere Tochter. Sie war in einem Tennis-Camp und zum ersten Mal allein verreist. Sie hatte die Nachricht im Radio gehört und war in Tränen aufgelöst. Aber Lia war nicht nur traurig. Sie war auch wütend, dass ich ihr zuvor nichts von dem Rausschmiss gesagt hatte.
Sie konnte nicht glauben, dass ich von all dem nichts geahnt hatte. „Wieso hast Du das nicht gewusst“, fragte sie, „Du bist doch Präsident einer großen Firma. Du weißt doch sonst immer, was läuft.“





