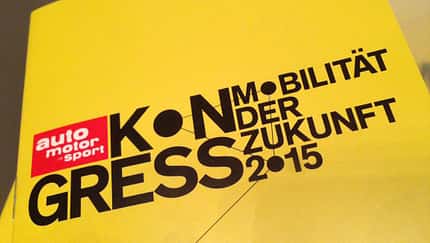Steht das Autonome Fahren kurz vor dem Durchbruch? Dauert es nur noch einen Wimpernschlag, bis Autofahrer im Stau die Zeitung lesen, während der Staupilot das Steuer übernimmt? Die Technik ist schon so weit, meinte Tim Ramms, der Leiter des Geschäftsbereiches Automobil der Motor Presse Stuttgart, als er am Morgen die Teilnehmer des auto motor und sport Kongresses 2015 begrüßte. Doch was in einer seriennahen S-Klasse schon möglich ist, wird im Masseneinsatz noch länger auf sich warten. Zu groß sind noch die Fragen, die gelöst werden müssen, wenn autonome Autos millionenfach auf der Autobahn unterwegs sind. Das war das Fazit des ersten Panels am Vormittag in der Messe Stuttgart.
Auto wird zum Lebensraum
Ralph Alex, Chefredakteur von auto motor und sport, lenkte in seinem Eröffnungsbeitrag zunächst den Blick auf die Elektromobilität. "24.000 E-Autos fahren im Moment in Deutschland. Es müssten aber schon 100.000 sein, wenn wir das Ziel erreichen wollen, 2020 eine Million Autos auf den Straßen zu sehen.“ So faszinierend Elektromobilität ist: Sie hat es weiterhin schwer.
Thomas Weber, Entwicklungsvorstand bei Daimler, hat die Mobilität der Zukunft klar vor Augen. "Das Auto der Zukunft fährt zunehmend elektrisch, zunehmend vernetzt und zunehmend autonom“, sagte Weber ist seinem Panel-Beitrag. Es gibt schon alternative Transportmöglichkeiten, die schneller sind als das Auto wie der öffentliche Nahverkehr, aber diese sind nicht so komfortabel“, so Weber, und zeigte Bilder überfüllter U-Bahnen in Megacitys.
Weber ist sich sicher, dass das Auto eine Zukunft hat, weil es auch in großen Städten einen geschützten Raum bietet, während es per Autopilot selbstständig fährt. "Will der Autofahrer im Stau selbst steuern? Das glaube ich nicht“, so Weber. "Will er Pedalarbeit leisten? Das will er auch nicht.“ Und deshalb werde das Auto "zum dritten Lebensraum“ neben dem Zuhause und dem Büro, so Weber, und blendet die Bilder des auf der CES in Las Vegas vorgestellten Forschungsautos F 015 ein. Der luxuriöse Innenraum, die Möglichkeit zur Entspannung, das sind für Weber zentrale Vorteile des Autos der Zukunft, während es autonom durch den Stau steuert.
Autopilot fährt sparsamer
Ulrich Hackenberg, Entwicklungsvorstand bei Audi, sieht einen weiteren Vorteil des Autonomen Fahrens im effizienteren Fahren. Pilotiertes Fahren sei auch effizienteres Fahren, so Hackenberg, es spare Kraftstoffe und damit CO2.
Wie leistungsfähig pilotiertes Fahren schon heute ist, erläuterte Hackenberg an den Beispielen der Autos Bobby, das ohne Fahrer mit hohem Tempo über den Hockenheimring gefahren ist, und Jack, das mit 120 km/h über öffentliche Straßen zur CES in Las Vegas gesteuert ist.
Dabei sieht Hackenberg in den Assistenzsystemen noch eine wichtige Funktion, um beim Ausfall eines Fahrers einen Unfall zu verhindern. "Pilotiertes Fahren hat auch die Aufgabe, ein Auto zu übernehmen, wenn beispielsweise der Fahrer einen Herzinfarkt erleidet“, so Hackenberg. Dass müsse das System versuche, das Auto sicher an den rechten Fahrbahnrand zu bringen. In solch wichtigen Funktionen sieht Hackenberg auch den Grund, warum das Pilotierte Fahren schnell Richtung Volumenmarkt weiterentwickelt werden sollte.
Harald Naunheimer, Entwicklungschef bei ZF Friedrichshafen, stellte den Nutzen neuer Assistenzsysteme in den Mittelpunkt. "Funktionen, die einen Mehrwert für den Kunden bringen, setzen sich durch“, so Naunheimer. "Dies gilt auch für hochentwickelte Fahrerassistenzfunktionen bis hin zum Autonomen Fahren.“
Beispiel Einparkassistent: "Die Idee ist brillant, sind es doch gerade Einparkmanöver, die in der urbanen Mobilität immer wieder herausfordernd sind“, so Naunheimer. "Auch diese Idee wird sich weiterentwickeln, für die Kunden einfacher werden und zu Recht durchsetzen.“
Zuvor hatte der ZF-Entwickler seine Begeisterung für Mister Q, den genialen Entwickler in den James-Bond-Filmen, durchblitzen lassen. Sprachsteuerung und ein Peilsender mit Kontrollbildschirm wurden schon 1964 in "Goldfinger“ im Aston Martin DB 5 eingeführt. Seiner Zeit ebenfalls weit voraus und für die damaligen Zuschauer reine Science Fiction war im Jahr 1997 die Fernsteuerung des BMW 750iL per Mobiltelefon in "Der Morgen stirbt nie“.
Heute, 20 Jahre später, ist dank Elektronik, GPS und Smartphone die Navigation und Internet im Fahrzeug alltäglich. Es ist sogar Realität, Fahrzeuge millimetergenau automatisiert zu bewegen.
Fahrrad als Bio-Hybrid-Zukunft
Darin sieht Naunheimer auch ein großes Potential, um vor allem die Lkw-Fahrer von lästigen Rangierzeiten zu entlasten. Wenn sich ein Lkw etwa bei Warten am Verladepunkt selbstständig bewegt, werde die Wartezeit des Fahrers zu seiner Ruhezeit.
Peter Gutzmer, Entwicklungsvorstand der Schaeffler AG, lenkte im Panel 1 den Blick auf das Fahrrad. Das Fahrrad werde in den Städten eine immer wichtigere Rolle spielen, so Gutzmer, und spricht von der Muskelkraft als Bio-Hybrid. Zum einen als individuelles Verkehrsmittel, zugleich aber auch als Verkehrsmittel in einer vernetzten Mobilität. "Wir erkennen klar den Trend hin zum Fahrrad bei der urbanen Mobilität“, so Gutzmer.
Der Schaeffler-Entwickler verweist auf die Vision Kopenhagen. Die Stadt hat sich vorgenommen, dass 2025 50 Prozent des individuellen Verkehrs mit dem Rad zurückgelegt werden. Ähnliche Programme haben auch andere Städte. London plane beispielsweise einen Fahrrad-Highway.
Markus Lienkamp, Professor für Fahrzeugtechnik und Leiter des Wissenschaftszentrums Elektromobilität an der TU München, unterstützte die Forderung von Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann, bei der Einführung autonomer Systeme stärker auf die Verkehrssicherheit zu blicken. Systeme zum Fußgängerschutz sollten so schnell wie möglich ins Auto einziehen.
Dagegen sind wir nach Einschätzung Lienkamps noch "weit entfernt“ vom Zeitung lesenden Autofahrer. Es sei zudem "der falsche Weg, mit zwei Maß Bier autonom gesteuert noch nach Hause zu fahren“.