Studien, die den CO2-Footprint von Produkten über deren gesamte Haltbarkeit mit Produktion, Nutzung und Recycling ermitteln, so genannte Life Cycle Analysis (LCA), klingen nicht nur aufwendig und kompliziert, sondern sind es auch. Sie sind aber die einzige Methode, den tatsächlichen CO2-Effekt bestimmter Produkte oder Technologien zu ermitteln – wenn sie wirklich alles Aspekte umfassend einbeziehen.
Studien von Wissenschaftlern für Wissenschaftler
Aufgrund der Vielzahl von erforderlichen Daten aus unzähligen Quellen, Berechnungen und Schätzungen ist das Fehlerpotenzial hoch. Und weil die Analysen oft auf große Stückzahlen hochgerechnet werden, ist die Auswirkung eines Fehlers aufs Gesamtergebnis enorm. Beispiel: Dass die Produktion einer E-Auto-Batterie viel Energie braucht, ist inzwischen hinlänglich bekannt. Dementsprechend groß kann der so genannte CO2-Rucksack eines E-Autos sein und danach richtet sich natürlich, wie lange ein E-Auto unterwegs sein muss, um den mit seinem CO2-armen (wegen der Stromerzeugung nicht CO2-freien) Betrieb hereinzufahren. Aber entscheidend ist dabei, wie viel CO2 die Energieerzeugung bei der Batterieproduktion emittiert. So manches Batteriewerk in China beispielsweise arbeitet mit überwiegend fossil erzeugtem Strom, viele deutsche Hersteller sind gerade dabei, den Grünstromanteil bei der Batterieproduktion Richtung 100 Prozent zu verschieben.
Nicht jeder Wissenschaftler ist Experte
Schon daran lässt sich erkennen: LCA sind klassische Betätigungsfelder seriöser Wissenschaft. Das steigert die Zahl der Fußnoten darin und macht sie komplex, sorgt aber für Überprüfbarkeit und Glaubhaftigkeit. Die Überprüfung ist Sache des Wissenschaftsbetriebs. Die Glaubhaftigkeit ist aber in in der Öffentlichkeit oft schon gegeben, wenn die Autorenschaft wissenschaftlich ist – oder so wirkt. Sprich: Wenn ein Institut die Studie herausgibt. Aber dabei ist Vorsicht geboten: Nicht jeder Wissenschaftler ist vom Fach, selbst renommierte vergaloppieren sich, wenn sie sich thematisch auf fremdes Terrain begeben. Prominentes Beispiel: Hans Werner Sinns (ifo-Institut) Wutrede übers E-Auto, das 2019 noch mit Zahlen der so genannten Schweden-Studie von 2017 arbeitete und zu der irrigen Annahme gelangte, Diesel führen CO2-günstiger als E-Autos. Da hilft nur die akribische wissenschaftliche Überprüfung aller Annahmen.
Der Absender der Studie ist wichtig
Noch offensichtlicher ist die Zweifelhaftigkeit von Studien, wenn als Herausgeber ein völlig unbekanntes Institut oder gar eine PR-Agentur fungiert und die Auftraggeber ein Eigeninteresse an dem einen oder anderen Ergebnis haben. So geschehen in Großbritannien. Dort griffen etliche Medien die Studie "Decarbonising Road Traffic: There is no silver bullit", publiziert und verbreitet von Clarendon Communications auf, die behauptet, ein Polestar 2 müsste in England 78.000 Kilometer fahren, um seinen größeren CO2-Rucksack aus der Produktion gegenüber einem Volvo XC40 hereinzufahren. Auf die durchschnittliche Jahresfahrleistung in Großbritannien bezogen wäre das sieben Jahre. Verschiedene Rezipienten kritisierten die Studie inhaltlich:
- Der Vergleich von WLTP-Verbräuchen bevorzugt Verbrenner, weil die bekannte Abweichung des Verbrauchs in der Praxis bei Benzinern und Diesel wegen des höheren CO2-Ausstoßes pro Kilometer größere Auswirkungen hat.
- Die Studie berücksichtigt zwar die CO2-Emissionen bei der Herstellung von Batterien, aber nicht die fossiler Kraftstoffe.
- Die Studie nimmt keine künftigen Veränderungen im Strommix von Großbritannien Richtung weniger CO2-Emissionen an, was vor allem im Hinblick auf die lange Lebensdauer von Autos unrealistisch ist.
- Bei der Verwendung der Daten aus der LCA-Studie (hier veröffentlicht) zum Polestar 2 hat Polestar-CEO-Thomas Ingenlath kritisiert, dass die Studie entscheidende Punkte der firmeneigenen Daten ausspare, die den CO2-Abdruck des Polestar 2 um bis zu ein Drittel senken würden, und klargestellt, dass der Polestar 2 über den Lebenszyklus einen niedrigeren CO2-Fußabdruck habe als ein vergleichbares Auto mit Verbrennungsmotor, egal, mit welchem Strom er geladen werde. Außerdem würden E-Autos einen Weg zur CO2-Neutralität ermöglichen, was Verbrenner naturgemäß nicht könnten.
- Auke Hoekstra von der Technischen Universität Eindhoven weist unter anderem auf Ungereimtheiten bei den CO2-Emissionen der Produktion des Gesamtfahrzeugs in der Studie hin und berechnet zusammen mit den anderen Fehlern einen korrigierten Amortisationspunkt für die CO2-Emissionen des E-Autos: Schon ab 24.000 Kilometern (also in Großbritannien nach gut drei Jahren Haltedauer) begännen die kulminierten CO2-Emissionen des Verbrenners die des E-Autos zu übersteigen.
Bis hierhin könnte man von einer weiteren fehlerhaften Studie ausgehen – wenn nicht auf der letzten Seite etliche Firmenlogos auftauchten. Und da finden sich zuvorderst Aston Martin, Bosch und Honda, weiter unten McLaren sowie ganz am Ende Clarendon Communications. Ein Kommentar oder eine Einordnung zu den Logos finden sich nicht, aber üblicherweise werden so die Auftraggeber einer Studie präsentiert. Wie Michael Liebreich, Gründer und Chef von Liebreich Associates und Regierungsberater in Transportfragen aufdeckte, sind die Firmen hier aber sogar die Autoren, im speziellen geht die "Studie" wohl auf den Chef-Lobbyisten von Aston Martin zurück, auf dessen Ehepartnerin Clarendon registriert ist, wie Liebreich, der auch Gründer von Bloomberg New Energy Finance ist und dort im Aufsichtsrat sitzt, herausfand. Pikant: nmittelbar nach Bekanntwerden der massiven Kritik an der Veröffentlichung verschwanden die Internetseite von "Clarendon Communications" sowie sämtliche Social-Media-Accounts der Firma.
"Studie" oder "Report" reicht nicht als Glaubwürdigkeitsbeweis
Daraufhin berichtete der Guardian über die inzwischen als "Astongate" Fahrt aufnehmende Affäre, nachdem andere britische Medien (u.a. Times, Daily Mail und Daily Telegraph) die Studie genüsslich mit dem von Boris Johnsons verkündeten Verbrennerverbot für 2030 kontrastiert hatten. Vielleicht auch, weil der Parlamentsabgeordnete Matt Western das Vorwort geschrieben hatte.
Der Politiker zeigte sich in der Folge "enttäuscht, dass die Studie dazu verwendet wurde, eine Anti-Elektrifizierungskampagne in den Medien loszutreten. Er habe mit seiner Unterstützung das Gegenteil im Sinn gehabt und nicht gewusst, dass es zwischen der PR-Agentur und Aston Martin eine Verbindung gebe.
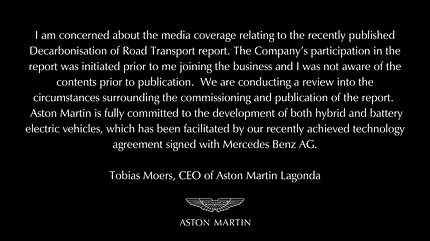
Aston will E-Autos bauen
Auch Aston Martins neuer Chef Tobias Moers distanzierte sich zwischenzeitlich von der Publikation. Sie sei vor seinem Antritt bei der britischen Traditionsmarke initiiert worden, die Inhalte habe er vor der Publikation nicht gekannt. Er kündigte eine Untersuchung an und erklärte, Aston Martin stehe voll zur Entwicklung von Plug-in-Hybriden und Elektroautos, zu deren Ziel das Unternehmen kürzlich eine umfassende Kooperation mit Daimler geschlossen habe . Moers war am 1. August 2020 von Mercedes-AMG zu Aston Martin gewechselt.
Ein offizielles Statement von Bosch UK lautet: "Die kürzlich veröffentlichte Studie Decarbonising Road Transport ist von zahlreichen Industrieunternehmen und Organisationen zusammengestellt worden und nutzt vorhandene, öffentlich verfügbare Daten. Alle Beteiligten unterstützen die Bemühungen der britischen Regierung den Straßenverkehr zu dekarbonisieren und setzen sich regelmäßig mit Politikern darüber auseinander. Alle Beteiligten haben bei der Studie entsprechend ihrer jeweiligen Expertise zusammengearbeitet, um den besten Weg zur Zielerreichung herauszuarbeiten".
McLaren etwa gibt auf Nachfrage von auto-motor-und-sport.de an, man habe nur Input zum Thema Leichtbau geliefert und nicht zum umstrittenen Teil über Elektroautos, mit der Beauftragung der Studie habe man nichts zu tun gehabt.
Honda äußerte sich auf Anfrage praktisch wortgleich wie Bosch, schob allerdings nach, dass man keine förmliche Verbindung zu der PR-Agentur Clarendon habe und auch nicht finanziell zur Studie beigetragen habe. Vereinbarungen anderer Unternehmen kommentiere man nicht. Auf erneute Nachfrage gab die Europa-Abteilung des japanischen Herstellers an, man habe für die Studie inhaltlichen Input "zur wichtigen Rolle, die die Hybridtechnologie neben der für rein elektrische Antriebe spielen könne, um die Ziele der Regierung zu erreichen, geliefert". Das erklärt auch das Firmenlogo auf der letzten Seite der Studie.
















