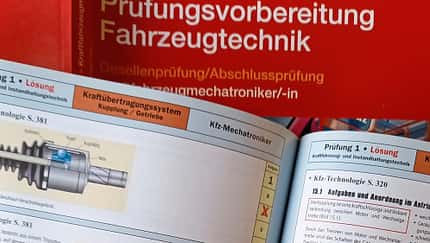Multiple-Choice-Aufgaben werden nach dem Antwort-Wahl-Verfahren beantwortet und ausgewertet. Heute noch sind die bekannten Fahrschulbögen, auf denen man die richtige Antwort ankreuzt, die typischen Vertreter dieser Prüfungsart. Besonders in den 70er-Jahren kamen diese Prüfungsaufgaben in den Berufsschulen und Ausbildungsbetrieben auf, heute aber stehen sie im Kreuzfeuer der Juristen.
B2
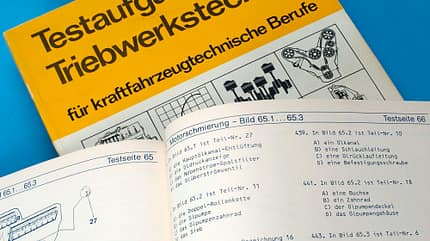
Seit den 1970er-Jahren sind Multiple-Choice-Prüfungsaufgaben beliebt
Die Suche nach einer umfassenden Abfrage des vermittelten Wissens, das durch Verordnungen gefordert wurde und in einer bestimmten Zeiteinheit ermittelt werden musste, machte es dem MC-System leicht, sich durchzusetzen. Insbesondere Zwischen- und Gesellenprüfungen erforderten einen immensen Zeitaufwand, um Tausende von Antworten auszuwerten. Hilfreich war dieses System auch dadurch geworden, dass es erstmalig möglich wurde, die Antworten von den Prüflingen auf einer Auswertkarte (Lochkarte) zu markieren und sie anschließend vom Prüfer maschinell auszulesen. Wenig Aufwand wurde dazu verwendet, um die Aufgaben auf Sinngehalt und Gewichtung zu analysieren. Schließlich setzt ein solches Unterfangen einen hohen Zeitbedarf voraus, der eigentlich nur von Hochschulen geleistet werden kann. Viele Prüfer sind aber nur ehrenamtlich verpflichtet.
Trotz der Mängel und der berechtigten Kritik der rudimentären Kommunikationsfähigkeit können die MC-Aufgaben in der Regel den Wissensstand des Prüflings ausreichend gut abbilden. Juristen finden jedoch nach langem Suchen immer einen Ansatzpunkt, um die Schwächen eines Prüfungssystems zu entlarven und gegebenenfalls auszunutzen.
Am 4. Oktober 2006 hat der 14. Senat des Oberverwaltungsgerichtes Münster (Aktenzeichen 14 B 1035/06) die Diplomvorprüfung eines Studenten der Uni Köln mit den strittigen MC-Aufgaben als unrechtmäßig anerkannt. Dazu sind im Beschluss des Gerichts Argumente angeführt worden, die mit der juristischen Lupe betrachtet nicht vom Tisch zu wischen sind.
Der Senat führte aus, dass in Klausurarbeiten der Prüfling nachweisen solle, dass er in begrenzter Zeit und mit beschränkten Hilfsmitteln Probleme mit den geläufigen Methoden des jeweiligen Fachs erkennen und Wege zu ihrer Lösung finden kann. Durch die Prüfung solle ein Prüfling nachweisen, dass er das Ziel des Grundstudiums erreicht und die Kenntnisse und Fähigkeiten erworben hat, die erforderlich sind, um das weitere Studium mit Aussicht auf Erfolg in einem angemessenen Zeitraum zu betreiben. Die strukturelle Besonderheit des MC-Verfahrens liege darin, dass die Prüfungsleistung je nach gewähltem Prüfungs- und Auswertungsmodus nur in einem Ankreuzen oder Nichtankreuzen der für richtig oder falsch gehaltenen, zum Teil auch der nicht gewussten Antworten bestehe. Der Prüfling habe keine Möglichkeit, die von ihm gewählte Antwort zu begründen und so zusätzliche Grundlagen für die Bewertung seiner Prüfungsleistung durch die Prüfer zu schaffen. Nach Abschluss der Prüfung finde nur noch eine rechnerische Auswertung statt, die keinen Raum für eine wertende Beurteilung lässt.
Gleichzeitig werden Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts angeführt. Dieses hat Grundsätze für die Durchführung von MC-Prüfungen aufgestellt. Danach sind bei Prüfungen in dieser Form die Voraussetzungen für den Erfolg oder Misserfolg vorher festzulegen. Dazu genügt nicht die Bestimmung einer absoluten Bestehensgrenze. Erforderlich ist auch die Bestimmung einer Bestehensgrenze im Verhältnis zu einer für möglich erachteten Höchstleistung oder einer Normalleistung. Damit ist es aber kaum möglich, den Schwierigkeitsgrad von Prüfungen im MC-Verfahren zuverlässig vorauszusagen oder gar zu steuern. Da es keine folgenden Prüferbewertungen gibt, in denen zutage tretende ungewollte Schwankungen im Schwierigkeitsgrad der Prüfungen verschiedener Termine Rechnung getragen oder in denen auf Fehler oder Missverständlichkeiten in der Aufgabenstellung eingegangen werden kann, müssen insoweit Regeln und Mechanismen vorher festgelegt werden. Daran allerdings fehlt es.
Der Senat bezweifelte, dass eine absolute Bestehensgrenze den Anforderungen an eine Prüfung standhält, die den Zugang zu einem Beruf beschränkt. Denn die ermittelte und für das Bestehen maßgebliche Punktzahl spiegle nur im Ausnahmefall unmittelbar wider, welche berufsbezogenen Kenntnisse der Prüfling durch richtige Antworten nachgewiesen hat. Richterlich ist dagegen bestätigt, dass ein Prüfling in einer konkreten Prüfung gleichbleibend leichtere Fragen richtig und schwerere Fragen falsch beantwortet, ein von der Lebenswirklichkeit nicht zwangsläufig bewiesener Punkt.
Aus dem Grundgesetz ergeben sich einige Ableitungen zum Prüfungsrecht, zum Beispiel ergibt sich nach Art. 12 (1) GG für berufsbezogene Prüfungen der allgemeine Bewertungsgrundsatz, dass eine vertretbare und mit gewichtigen Argumenten folgerichtig begründete Lösung nicht als falsch bewertet werden darf.
Die TU Dresden hatte zu den MC-Aufgaben extra eine Broschüre herausgebracht. Hier eine kleine Kostprobe: "Zur Gesamtbewertung werden die Rohpunkte aller MC-Aufgaben addiert. Von der Summe wird der mit Verfahren der statistischen Wahrscheinlichkeitsrechnung ermittelte Erwartungswert der Rohpunkte abgezogen, der sich bei rein zufälligem Ankreuzen der Antworten ergibt. Dann werden aus den verbleibenden Rohpunkten (Netto-Rohpunkte) Prozentpunkte als relativer Anteil der erreichten Netto-Rohpunkte an den insgesamt erreichbaren Netto-Rohpunkten der Prüfung gebildet. Kommastellen werden abgeschnitten. Anschließend werden aus den berechneten Prozentpunkten Punkte für den jeweiligen Prüfungsteil zugeordnet, wobei 100 Prozentpunkte dem Anteil der MC-Aufgaben an den insgesamt in der Prüfung erreichbaren Punkten entsprechen." Und? Wer hat dieses Beamtendeutsch verstanden?
Werden wir in Zukunft neben den Prüfern auch zwei unabhängige Juristen sehen, die die Rechtmäßigkeit von Prüfungsaufgaben kontrollieren, protokollieren, abändern, verifizieren, falsifizieren und zertifizieren? Auch hier lautet die Antwort: Wohl kaum.